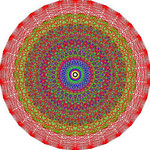In Einbeck unerwünscht
Autobiographische Skizze einer Vertreibung
Bei dem folgenden Text handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem Leben von Alfred K., einem der 58 Einbecker Juden, die im Juni 1933 in einer „Judenkartei“ als so genannte „Glaubens-Juden“ von den Nationalsozialisten behördlich erfasst wurden und später (ab September 1941) den "Gelben Stern" tragen mussten und nicht mehr auswandern durften. Zunächst wird Alfreds mittelalterliche Heimatstadt Einbeck aus heutiger Sicht beschrieben und anschließend sein letzter Tag als Bürger dieser Stadt, mit der sein Leben so eng verknüpft war. Alfred lebte von seiner Geburt (1907) an 29 Jahre in Einbeck bevor er 1936 ein Jahr nach dem Freitod seines Vaters nach Palästina emigrierte und im Frühjahr 1964 in seine Heimatstadt zurückkehrte und hier bis zu seinem Tode 1989 blieb. Die Geschichte ist in weiten Teilen authentisch und zeigt exemplarisch die Situation der deutschen Juden zu Beginn der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Alfred kehrte als einziger der aus Einbeck vertriebenen Juden in seine Heimatstadt zurück, weil hier seine familiären, persönlichen und insbesondere auch seine politischen Wurzeln waren, die ihn für sein ganzes Leben geprägt hatten und letztendlich auch nach Einbeck in seine von Kindheit an vertraute Umgebung zurückkommen ließen. Er ist 1989 im Alter von 82 Jahren in Einbeck gestorben und wurde mit seiner Frau Miriam auf dem Stadtfriedhof bei seinem Vater Theodor K. begraben.
Am Alten Rathaus von Einbeck erinnert seit dem 9. November 2008 eine Gedenktafel, die auf meine Initiative hin dort angebracht wurde, an die ehemaligen jüdischen Bürger und Bürgerinnen der Stadt, die in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1944 verfolgt, vertrieben, deportiert und viele auch ermordet wurden. Alfreds Name und die Namen seiner Eltern sind darunter.
Der Tag unserer "Abreise" war festgelegt. Der amtliche Bescheid des Bürgermeisters als Vorsteher der Ortspolizeibehörde erreichte uns eine Woche vor dem angesetzten Termin.
Es war an einem grauen Oktobertag des Jahres 1935, der auch in Einbeck den sonst so prächtigen Fachwerkhäusern ihren Glanz nahm. Wir gingen mit unserem wenigen Handgepäck, dessen Gewicht und Inhalt man uns genau vorgeschrieben hatte, den kurzen Weg zur Ortspolizeibehörde im Landrats-amt, um dort in einen Bus der Stapo-Leitstelle Hildesheim einzusteigen, der uns zum „Sammellager für Ausreisewillige Juden“ nach Hannover bringen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war auf diese Weise bereits die Hälfte der Mitglieder unserer kleinen Einbecker Gemeinde abgeholt worden. Der Busfahrer und ein Begleiter warteten schon im Hof des Gebäudes. Wir waren nicht die einzigen Juden, die an diesem frühen Morgen die Stadt verließen. Ludwig Danzig war da sowie Walter Dannenberg mit seinem sechsjährigen Sohn Gerd und die weit über siebzigjährige Jenny Franck. In der gegenüber liegenden Mittelschule, einem roten Backsteinbau aus dem vorigen Jahrhundert, wo ich Anfang der 20er Jahre die Mittlere Reife gemacht hatte, brannte schon vereinzelt Licht hinter den Scheiben. Auf dem übrigen Möncheplatz und am Neuen Markt war es noch dunkel. Die Fachwerkhäuser an der Langen Brücke standen trostlos und einsam ohne ein Anzeichen von Leben da. Der Nieselregen lief die Dächer hinab in die Traufen und auf dem Kopfsteinpflaster hatten sich Pfützen gebildet. Es war neblig trüb und kalt und jeder von uns prüfte noch einmal, ob Kennkarte, Reisepass, Visum usw. an ihrem Platz und griffbereit waren. Der Großteil unseres Vermögens wurde beschlagnahmt bzw. auf den Konten gesperrt, ein weiterer Teil steckte neben den eigentlichen Reisekosten in der Zwangsabgabe an die „Reichs-zentrale für jüdische Auswanderung“, der so genannten „Reichsflucht-steuer“, in diesen, für die Emigration erforderlichen Papieren.
Ich dachte zurück an den Freitod meines Vaters, der in Einbeck in der Bahnhofstraße am früheren Bürgermeisterwall ein Bankhaus besaß, das er von meinem Großvater übernommen hatte. In diesem Haus wurde ich als Alfred K. geboren, hatte dort meine Kindheit und Jugend verbracht, eine kaufmännische Lehre als Bankkaufmann begonnen und abgeschlossen und meinen Arbeitsplatz gefunden.
Von hier aus führte mich mein täglicher Weg in die Stadt, die Bahnhofstraße hinunter, an Mittelschule, Möncheplatz und Neuem Markt vorbei über die Lange Brücke zum Markplatz, der sich von hier bis zur Marktkirche im Hintergrund allmählich erweiterte und vor der Kirche zwischen Rathaus und Brodhaus seine größte Ausdehnung erreichte.
Hier saß ich mit meinen Freunden Albert, Ernst, Heinrich und Karl auf den Simsen der Schaufenster oder auf den Treppenstufen des Rathauses, der Ratsapotheke oder der Ratswaage und beobachtete das Treiben auf dem Marktplatz oder spielte unter den Kastanien an der Rückseite der Marktkirche. Wir hatten eine glückliche Kindheit und Jugend und liebten unsere Stadt, hielten zusammen; sie gingen als Arbeiterkinder in die Volks-schule, ich war auf der Mittelschule; zusammen traten wir später der SPD bei.
1933 waren die Nationalsozialisten an die Macht gekommen und hatten uns Juden durch Gesetze und Verordnungen aus dem öffentlichen Leben verdrängt und unsere Lebensbedingungen so eingeschränkt, dass unsere Existenz auf dem Spiel stand. Sie hatten verschiedene jüdische Vereine und Organisationen aufgelöst, Geschäfte von Juden boykottiert und geschlossen, uns den Zugang zu Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen verwehrt und auf dem Marktplatz eine „spontane Kundgebung“ gegen das Judentum durchgeführt. Daraufhin waren Juden in Einbeck offiziell unerwünscht und einige Einbecker Unternehmen, darunter auch die Brauerei, versicherten in Zeitungsannoncen, im „Einbecker Tageblatt“, rein arisch zu sein. Wir gehörten zwar der kleinen jüdischen Gemeinde an, fühlten uns aber mehr als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, wobei wir es mit dem Glauben nicht so genau nahmen. Wir waren bekannt mit den Adlers, Jordans, Herzbergs, Sollingers, mit den Brüdern Goldschmidt und den restlichen Juden, meist angesehene Bürger und Geschäftsleute in Einbeck. Ich habe erst nach dem Krieg erfahren, was mit ihnen geschehen ist. Aber auch zu den „Ariern“, zu denen sie durch die im Herbst 1935 vom Reichstag verabschiedeten Nürnberger Gesetze, die eine Zweiklassengesellschaft aus „Ariern“ und Juden etablierten, gemacht wurden, hatten wir wenn auch keine gesellschaftlichen, so doch geschäftliche Beziehungen. Da mein Vater aktives Mitglied der sozialdemokratischen Partei war und Mitarbeiter beim „Volksblatt“ und ich mich in der sozialistischen Arbeiterjugend als Jugend-leiter engagiert hatte, waren wir von den Nazis doppelt verdächtig und gefährdet. Die SPD war bereits 1933 verboten und ihre Mitglieder aus dem Stadtrat und allen öffentlichen Ämtern entfernt worden. Viele wurden in „Schutzhaft“ genommen und in Konzentrationslager gebracht. Nur ein ganz kleiner Kern war weiterhin illegal tätig, feierte insgeheim den 1. Mai und riskierte eine Verhaftung wegen Staatsfeindlichkeit, Antipropaganda, Heimtücke, politischer Verunglimpfung oder gar Wehrkraftzersetzung und Hochverrat. In rascher Folge gründeten sich neben den schon bestehenden NS-Organisationen NSDAP, SA, SS und HJ eine Vielzahl weiterer NS-Gruppierungen und -Vereine mit den zugehörigen Geschäftsstellen in der Stadt. Es verstand sich von selbst, dass Juden zu diesen Vereinigungen keinen Zutritt hatten. Meine Mutter musste sich als „Volljüdin“ aus dem vaterländischen Frauenverein des DRK, in dem sie Mitglied war, Anfang 1934 „zurückziehen“. Mein Vater war auf seine „arischen“ Kunden angewiesen, die nach und nach ausblieben. Es kam hinzu, dass zuvor sein größter und bester Kunde, die Firma Stukenbrok, als Folge der Wirtschafts-krise Konkurs angemeldet hatte und ihren Versandhandel, den ersten seiner Art in Deutschland, einstellen musste. Als Bankier unterlag er plötzlich dem Vorurteil und Feindbild, ein raffgieriger Jude zu sein, der nur darauf aus ist, seinen Mitmenschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das, obgleich er in vielen Jahren seiner Geschäftstätigkeit unter Beweis gestellt hatte, ein verlässlicher Geschäftsmann zu sein und ein angesehenes Unternehmen zu führen! Jetzt lebte er, aus seinem Bank- und Wohnhaus vertrieben, zurück-gezogen von einer kleinen Pension mit der Familie in einer Mietwohnung am Langen Wall 28 in der Nähe von Ilmebahn, Münsterkirche und Gymnasium außerhalb der Innenstadt. Es dauerte nicht lange, dann stand er vor dem wirtschaftlichen Ruin und als uns unsere "arischen" Bekannten und Freunde uns auf der Straße nicht mehr grüßten und so taten als würden sie uns nicht kennen, nahm er sich Anfang 1935 das Leben.
Der Busfahrer, der für alle sichtbar auf dem Revers seines Mantels das Goldene Parteiabzeichen trug, forderte uns zum Einsteigen auf. Man merkte ihm an, dass er sich einer lästigen Pflicht ohne viel Fragen zu beantworten und Erklärungen abgeben zu müssen, entledigen wollte. Ich fühlte mich von allen im Stich gelassen, fremd und ausgestoßen und war den Tränen nahe. Meiner Mutter ging es ebenso. Meine Gedanken eilten zum Marktplatz, über den Hallenplan, die Knochenhauerstraße hoch bis zum Eicke’schen Haus in die Marktstraße und von dort rechts an der Ratswaage und dem Rathaus mit dem dort im „Stürmerkasten“ ausgehängten antisemitischen Hetzblatt der Partei vorbei zur Langen Brücke und wieder zum Möncheplatz zurück. Ein plötzlicher Schnelldurchlauf vor dem inneren Auge überkam mich wie er bei Sterbenden vorkommen soll. Der Bus fuhr von der Bahnhofstraße am „Braunen Haus“, dem Sitz der Kreisleitung und der Ortsgruppe der NSDAP, an den nass herunterhängenden Hakenkreuzfahnen und an der Mittelschule vorbei um den Möncheplatz herum zum Rosenthal und bog an dessen Ende rechts in die Altendorfer Straße ein. In Höhe der „Traube“, dem Versammlungsort der Partei, begegneten uns die ersten Frühaufsteher vielleicht aber auch die letzten Besucher eines Kameradschaftsabends vom Vortag. Hinter dem Hotel Goldener Löwe, dem Verkehrslokal der SA, warf ich einen kurzen Blick die Marktstraße hinunter zum schiefen Turm der Marktkirche. Während der Reformationszeit, im ausgehenden 16. Jahrhundert, waren die Juden schon einmal aus Einbeck vertrieben worden, woran ein fanatischer, evangelischer Pfarrer dieser Kirche mit seinen Hetztiraden einen wesent-lichen Anteil hatte. Ich erinnerte mich jetzt daran und es kam trotz aller Ohnmacht, Bitterkeit und Enttäuschung plötzlich eine unbeschreibliche Wut in mir hoch und ich wusste, dass ich allen Schikanen und Anstrengungen der Nazis zum Trotz uns loszuwerden, wiederkommen würde, um mein Leben in dieser Stadt, in der Stadt meiner Kindheit, meiner Eltern und Großeltern – in meiner Heimatstadt fortzusetzen und zu beenden. Als wir über die Brücke am Hullerser Tor die Stadt in Richtung Kuventhal verließen, lichtete sich der Nebel und es wurde langsam hell. Vor uns lag eine Fahrt mit ungewissem Ausgang. ‚Ich werde nach Palästina gehen und kämpfen!‘ schwor ich mir als der Bus im Bereich des äußeren Walls die freie Landschaft erreichte und sich auf der Hannoverschen Straße am Krummen Wasser entlang nach Norden wandte.
Niemand in Einbeck hatte von unserer "Abreise" etwas mitbekommen und nach dem Krieg stellte man keine Fragen nach unserem Verbleib bis zu dem Tag, an dem ich zurückkam – aber da waren fast 30 Jahre vergangen.
⁎
Bezug: Diese Internetseite unter Sachtexte NS-Geschichte/Gedenktafel Einbeck/Leserbrief).
"Auch in Einbeck sei damals das jüdische Leben erloschen. Daran und an Alfred Kayser habe Dr. Manfred Burba soeben beispielhaft in der Einbecker Morgenpost erinnert" (Einbecker Morgenpost vom 11.11.2011).
Beurteilung der Kurzgeschichte im Rahmen meines Schriftstellerstudiums (vgl. dazu auch: "Einbeck. Eine Ortsbeschreibung" auf dieser Internetseite unter "Sachtexte/NS-Geschichte/Gedenktafel Einbeck"):
"Sie liefern eine äußerst ausführliche Ortsbeschreibung, welche sich ebenso getreu in Ihrer nachfolgenden Erzählung widerspiegelt. Bravo! Ebenso beeindruckend wie mitreißend ist die in der Ich-Erzählsituation verfasste autobiografische Geschichte eines Judenjungen, die Weltgeschichte, Politik, Wirtschaft und individuelles Schicksal miteinander zu verbinden versteht, sodass ein universaler wie persönlicher Eindruck entsteht. Es ist gerade das packende Schicksal eines (nicht irgendeines!) Individuums, welches Zeitgeschichte und Emotionalität in höchstem Grade miteinander verknüpft: und dieses darum umso authentischer erscheinen lässt. Bravo! Eine ganz und gar gelungene Leistung" (A. Eryigit-Klos, Lektorin).
Manfred Burba, Einbeck.